
COMFORT STATIONS, 2018 © Ojoboca
Ojoboca (Anja Dornieden und Juan David González Monroy) machen zugleich mehr und weniger als „Kurzfilme“. Mehr, weil sie neben Filmen auch Performances und Installationen entwickeln, derzeit an ihrem zweiter Langfilm arbeiten und Texte von einer eigenwilligen Literarizität fast alle ihre Bewegtbildarbeiten begleiten. Und weniger, weil sie bewusst unsere Erwartungen an konventionelle filmische Formen und Genres unterlaufen, bis hin zur Vorstellung vom einzelnen „Werk“, an deren Stelle eine umfassendere Praxis tritt, die das Kino als institutionellen und psycho-physischen Raum bespielt: „Orrorism, eine simulierte Methode innerer und äußerer Transformation“.[1] Was ihre Filme anzutreiben scheint, sind nicht die Künstler/Autor:innen, sondern der Filmapparat und die narrativen, illusionistischen, manipulativen Kräfte, mit denen er von uns Besitz ergreift, uns an- und in die Irre leitet.[2] In diesem Sinne ist es nur konsequent, wenn auch Dornieden und González Monroy ihre Autorschaft mit dem gemeinsamen Label „OJOBOCA“ camouflieren. Angelehnt an Pasolinis Vorstellung von der Kamera als „occhio-bocca“ oder „reality-eater“, somatisiert der Begriff auch den Moment der Filmerfahrung: als ein Sehen, das verschlingt und sich verschlingen lässt.
Die Filme von Ojoboca inszenieren unser Verhältnis zur (belebten) Welt als ein Drama von Nähe und Distanz, bei dem Fiktion und Wirklichkeit, Vorgefundenes und Phantasiertes immer ineinander verwoben sind. Comfort Stations (2018), ein Film, der laut Beschreibung gefunden und als möglicher Bestandteil eines psychologischen Tests identifiziert wurde, verbindet Momente des Naturfilms und der Faszination am So-noch-nie-Gesehenen mit einer Soundcollage, die erratisch zwischen unterschiedlichen Versionen und Versatzstücken des Jazzklassikers Dream (When You’re Feeling Blue) springt. Wir sehen Makroaufnahmen unberührter Natur – taubedeckte Pflanzen, Kaulquappen, Schnecken – deren Nähe mal anzieht, mal abstößt. Auch eine bräunliche, blubbernde „Ursuppe“ vermittelt eine Ahnung davon, dass das Leben, das uns hier gezeigt wird, keinen Anlass zur Verklärung gibt. Im Verlauf des Films variieren die Motive und werden nach und nach dramaturgisch von ihm einverleibt: als Kulisse für farbig wabernde Rauchwolken oder als Spektakel eigenen Rechts, wie eine von Feuerwerk verzehrte Pusteblume, der Waldboden im Stroboskoplicht oder die zur buntglitzernden Lava mutierte „Ursuppe“. Landschaften wandeln sich zu Tatorten, während auch der Soundtrack sich unheilvoll verlangsamt.
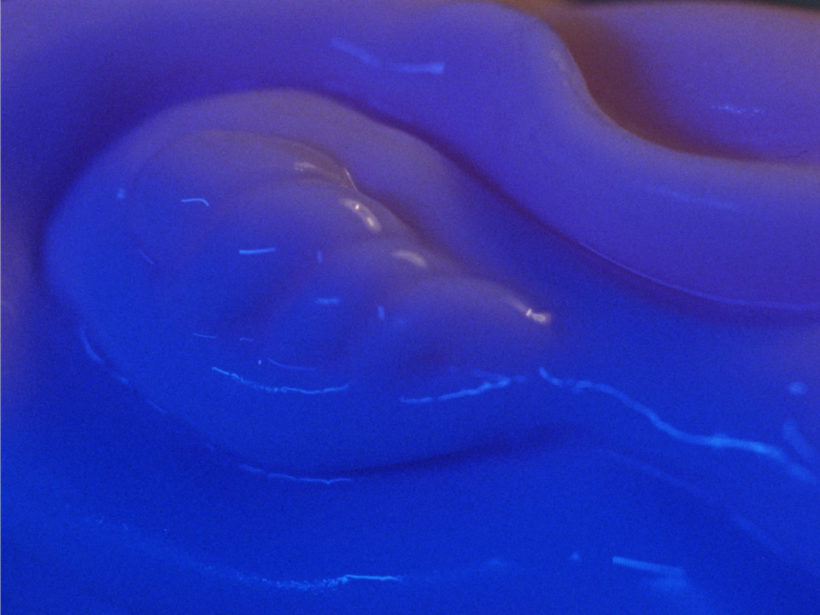
THE SKIN IS GOOD, 2018 © Ojoboca
Close-ups von menschlicher Haut in Schwarzweiß, von Augen und Mündern durchbrechen die Naturaufnahmen, vielleicht um an den Ort zu erinnern, an dem sich die sinnliche Berührung mit und Entfernung von dieser Welt ereignet. Ähnlich wie in The Skin Is Good (2018) ist die Haut zugleich begehrt und gefürchtet als Ort des Übergangs, als poröse Kontaktzone zwischen Selbst und Welt. Das Leben, das der Film beschwört, ist offensichtlich zwiespältig. Während er die Fragilität alles Belebten vorführt, gibt er sich zugleich als derjenige zu erkennen, der Leben verleihen und verlängern kann: das Medium, in dem die Natur noch weiterexistiert, auch nach ihrem Ende. Der Film schließt mit einem ekstatischen Tanz zähflüssiger Materie, in der alles aufgeht und alles möglich ist.

INSTANT LIFE, 2021 © Ojoboca
Auch bei ihrem jüngsten Film Instant Life (2021) handelt es sich nach Aussagen der drei Autor:innen – der Film entstand in Kooperation mit Andrew Kim – nicht um ein originales Werk, sondern um eine Bild-für Bild-Reproduktion eines Kompilationsfilms, dessen einzelne Teile sich auf einen Vorläufer gleichen Titels beziehen. Bestandteil aller Filme sei ein Rätsel ohne Auflösung – das wohl schon in dieser verschachtelten Vorgeschichte seinen Anfang nimmt. Instant Life erweckt seine Vorgänger zu neuem Leben – zu drei Leben, die aber dramaturgisch aufeinander bezogen sind. Wir sehen wachsende und zerfallende Kristalle und Zellstrukturen, aufziehende Stürme, wabernde Nebel, triste Nichtorte und glitzernde Salzseen, vorgefunden oder mit analogen Effekten erzeugt und durch Licht und Filter koloriert. In diesem über-natürlichen Kosmos ist das Wachstum ebenso exzessiv wie der Verfall, beide sind nur mit List in Schach zu halten. Nach und nach wird die Künstlichkeit der Szenerien offengelegt, doch je offensichtlicher die Tricks und Täuschungen, und je nachdrücklicher die Warnung vor ihrer zersetzenden Kraft, umso verlockender erscheint es, die Illusionen und Widersprüche dieser Erzählung in Bild, Text und Stimme für wahr zu nehmen und ihnen zu folgen.

INSTANT LIFE, 2021 © Ojoboca
Instant Life ist ein performativer Lehrfilm über die Erzeugung künstlichen Lebens und die prekären Bedingungen, unter denen es fortbesteht oder vergeht. Es ist zugleich eine Studie zur Psychopathologie des Filmapparats, dessen Perversion sich uns in einem unlösbaren Rätsel offenbart. In der alchimistischen Logik von Instant Life kommt beides zusammen. Das künstliche Leben, von dem hier die Rede ist, ist auch das Leben des Films. Es sind die vorgefundenen oder fiktionalen Orte und Wesen, von denen er handelt, aber auch seine eigene Existenzweise in prekären Verwertungszyklen und gestörten Habitaten. Instant Life erzählt auch von seiner eigenen Entstehung aus fragilen und „handgemachten“ Materialien, aus fast nichts und aus allem, was Hollywood verneint oder verleugnet.
Die besondere Haptik von Ojobocas Filmen verdankt sich auch diesem „Handgemachten“: der Arbeit mit 16mm-Film und in selbstorganisierten Analogfilmlaboren.[3] Trotz (oder dank?) der starken physischen Präsenz des Materials sind die Filme zeitlich oft nicht einzuordnen, so als zielten sie bewusst auf einen unbestimmten Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft. Dort verorten sie auch die Texte, die als Beschreibungen die meisten ihrer Werke begleiten. Sie handeln von gefundenem Film- und Textmaterial und den Umständen, unter denen die Künstler:innen in ihren Besitz gekommen sind, von geschichtlichen Ereignissen und ihren Widergängern, (pseudo-)wissenschaftlichen Experimenten und Séancen, die sich oft in weiterführenden „Quellen“ labyrinthisch verzweigen. Sie behaupten historische Tiefe und kausale Verbindungen und legen Fährten wie dekorative Schnörkel. Sie weigern sich standhaft, das letzte Wort zu haben über einen Film und seine Autor:innen und sind damit die Antithese zu herkömmlichen Filmbeschreibungen. Sind die Künstler:innen bei einem Screening anwesend, wird der entsprechende Text vor Filmbeginn verlesen und damit zum Teil der Vorführung. Auch hier wird nicht erklärt, sondern ein ritueller Übergang vollzogen: Wer daran teilhat, erklärt sich bereit zu allem, was folgt. Das Experiment kann beginnen.

HELIOPOLIS HELIOPOLIS, 2017 © Ojoboca
Jenseits der Texte haben auch die Filme selbst eine eigenwillige Art uns zu adressieren. Nicht wenige von ihnen sprechen uns direkt an. Gelegentlich lassen sich diese Stimmen identifizieren oder Figuren zuordnen, oft sind sie auch bloße Stimme – anonymes, körper- und gesichtsloses Medium der Anrufung. In Heliopolis Heliopolis (2017) bildet eine legendäre prähistorische Modell-Stadt gleichen Namens, ein optimiertes Double des realen Heliopolis, den Hintergrund für deren spekulative filmische Rekonstruktion. Zwei Computerstimmen richten sich wechselseitig an ein „You“ (an uns?), und weisen es an, laut Texte vorzulesen, die auf Farbtafeln vor uns auf der Leinwand erscheinen. Unterschiedliche Definitionen von „Inside“ und „Outside“ wechseln sich mit Aufnahmen brennender, teils um ihre eigene Achse rotierender Motivkerzen ab, die in Zeitraffer vor unseren Augen zerfließen. Während sich die Konturen der Dinge verflüssigen und sich die beiden Stimmen zusehends miteinander verschränken, verlieren auch die Definitionen ihre Trennschärfe, werden immer irrsinniger, so als würden sie sich gegenseitig verformen, verdoppeln, verschlingen und wieder ausscheiden.
Die imaginäre historische Stadt als sinnerfülltes Weltgebäude, gespiegelt im Ordnungssystem Sprache, seinen Grenzziehungen, Ein- und Ausschließungen, wird in dieser filmischen Imaginationsübung nicht neu errichtet, sondern im freien Spiel des Widersinns ein weiteres Mal demontiert. Je genauer wir dem Film folgen, uns seinen Anweisungen unterwerfen, umso mehr entgleiten uns die Anhalts- und Orientierungspunkte. Wer spricht hier eigentlich? Und wer hört zu? Innen und Außen wechseln die Seiten, stülpen sich ineinander, schließen uns immer gleichzeitig ein und aus. Diese „Übung“ erscheint wie die perverse Kopie jenes direkten Rapports, der gemeinhin zwischen Film und Zuschauer:in in einer Kinosituation angenommen wird, wie der Versuch, die konventionelle Sprache des Kinos solange mit Absurdem und Abjektem anzufüllen, bis sie implodiert. Womöglich sind also gar nicht wir die Proband:innen dieses Experiments, sondern der Film selbst?

THE MASKED MONKEYS, 2015 © Ojoboca
Sind diese Arbeiten auch als Kommentar auf das Experimenthafte des Experimentalfilms zu verstehen, das zwischen Science und Séance changieren kann, ist etwa The Masked Monkeys (2015) in Form und Inhalt stark auch auf dokumentarische Traditionen bezogen. Der Film basiert auf Material, das im Rahmen einer Recherche zur traditionellen (inzwischen verbotenen) Dressur maskierter Affen in Indonesien entstand. In grobkörnigen schwarz-weißen Aufnahmen zeigt der Film menschliche Trainer und ihre tierischen Performer bei der Arbeit und in der Freizeit, begleitet von einem nüchtern gesprochenen Kommentar, dessen Duktus unmittelbar an frühe anthropologische Filme denken lässt. Ist der Kommentar zunächst beschreibend und analysierend – eine Kontextualisierung „fremder“ kultureller Praktiken – wechselt er im Verlauf des Films fast unmerklich das Register und kulminiert am Ende in einer Vision universaler Harmonie und Erlösung. Dieser schleichende Wechsel in der Perspektive der Sprecherin spiegelt sich im semantischen Gleiten, das der Text zwischen Darsteller und Rolle, historischem Vorbild und gegenwärtiger Verkörperung, menschlichem und tierischem „Master“, bzw. (post-)kolonialer und künstlerischer Beherrschung, erzeugt. Visuellen Ausdruck findet dieses Changieren in einer hypnotischen, fünfminütigen Flicker-Sequenz etwa in der Filmmitte – der Großaufnahme eines Affengesichts in Menschenmaske. The Masked Monkeys überträgt den Zustand der Ciné-Trance, mit dem Jean Rouch seine Arbeitsweise beschrieb,[4] von den Produzent:innen auf die Rezipient:innen der Bilder: ein gleichzeitiges Innen- und Außensein im Verhältnis zu den Ritualen einer fremden Wirklichkeit, ein Angestecktwerden vom Gesehenen, das nicht nur den Objektivitätsanspruch dokumentarischer Bilder, sondern auch die Empfindung kultureller Distanz oder moralischer Überlegenheit angesichts einer als befremdlich wahrgenommenen Kulturpraxis in Frage stellt.

A FLEA’S SKIN WOULD BE TOO BIG FOR YOU, 2013 © Ojoboca
Die dem Film vorangestellte Programmatik – „to inform and not to amuse“ – ist noch für ein weiteres dokumentarisches Projekt richtungsweisend, A Flea’s Skin Would Be Too Big For You (2013). In dessen Zentrum stehen Performer:innen, die in einem chinesischen Themenpark die Bewohner:innen eines phantastischen Zwergen-Reichs verkörpern – die Projektion eines vorindustriellen Ersatzparadieses in die kommunistische Gegenwart. Von letzterer scheinen nur Bruchstücke auf, etwa wenn sich die Darsteller:innen in ihrer Freizeit über ihre Familien und Heimatorte austauschen, die sie, oft Tausende Kilometer entfernt, für die Arbeit verlassen mussten. Im übrigen Verlauf bleibt der Film konsequent im Hoheitsgebiet der Zwerge, begleitet sie bei der Arbeit im Park und auf der Bühne, lässt sie aber auch Tänze, Songs und Moderationen eigens für die Kamera performen. Was sich an unterschwelligem Unbehagen angesichts dieser Inszenierung von sozial Benachteiligten vor der Kamera einstellen mag, wird mit einer Wendung zum Ende des Films aufgegriffen und gekippt. Einer der Darsteller spricht unzählige Male „Thank you“ direkt in die Kamera – mal zugewandt, mal automatisch, mal widerwillig – und macht damit deutlich, dass diese Danksagung beauftragt wurde, und zwar für uns. Wir werden als diejenigen angesprochen, deren Präsenz diese Inszenierung überhaupt erst ermöglicht hat. Reiben wir uns also an der filmischen Repräsentation eines Systems, das marginalisierte Leben als Spektakel ausbeutet, sind wir bereits als Teil davon entlarvt. Die Schlussperformance deutet im Widerwillen des Protagonisten nicht nur einen Moment des Aufbegehrens an, sondern auch eine Möglichkeit, diesem System ein Stück Freiheit abzukaufen, indem man das eigene Anderssein exotisiert und zur Ware macht.
Die Filme von Ojoboca, ob sie nun eher experimentell oder dokumentarisch angelegt sind, entwickeln einen hypnotischen Sog, der unseren gesamten sensorischen Apparat erfasst. Dabei geht es nie um bloße Immersion, um ein passives Ein- oder Abtauchen, sondern um die unmittelbare Erfahrung des Impliziertseins in oder Infiziertsein durch die Wirklichkeit, die uns der Filmapparat zu sehen gibt. Es ist, als wollten sie unsere Antikörper aktivieren, damit wir auf der Hut sind vor diesem Apparat, der nur vorgibt, mit uns gemeinsame Sache zu machen.
[1] http://ojoboca.com/about-ojoboca/
[2] Mit „The Unpossessable Possessor“ betitelten Dornieden und Monroy eine Programmreihe für das European Media Art Festival 2021, in der sie dem Eigensinn des filmischen Apparats nachgingen, seinen Handlungen und Absichten, Begehren und Entgleisungen. Vgl. https://2021.emaf.de/sektionen/
[3] Beide sind Mitglieder des von Künstler:innen betriebenen Filmkollektivs LaborBerlin.
[4] Vgl. Jean Rouch, Ciné-Ethnography, hg. von Steven Feld, Minneapolis: University of Minnesota Press 2003, S. 39.
Beitragsbild: COMFORT STATIONS, 2018 © Ojoboca