
GLÜCKSPFAD © Thea Sparmeier, Pauline Cremer, Jakob Werner
Wann eigentlich ist der Zeichentrickfilm ins Hintertreffen geraten gegenüber einer Fülle von Animationsfilmen unterschiedlicher Techniken? Streng genommen ist ja selbst James Camerons Überwältigungsepos „Avatar“ zu weiten Teilen reine Animation, die Schätzungen belaufen sich auf 60 Prozent animierte Anteile. Das Zusammenspiel modernster VFX, CG Animation und Motion Capture hat nur noch wenig mit einem „Realfilm“ – also mit einer durch die Kamera eingefangenen real existierenden Schauspielperformance (Spielfilm) oder Wirklichkeit (Dokumentarfilm) – zu tun. Die von einer Kamera abfotografierten Blätter des analogen Zeichtrickfilms wiederum ergeben nur dann einen „Realfilm“, wenn es Konsens ist, dass jeder Film auch als Dokumentarfilm durchgehen kann. In der Tat: Gefilmtes und Abfotografiertes existiert vor der Kamera immer auch als reale Wirklichkeit. Aber macht das die Sache nicht nur noch komplizierter?
Man merkt: Wenn ich nun laut über Berührungsängste der Filmkritik mit dem Animationsfilm nachdenke, begebe ich mich auf gefährliches Glatteis. Weder schätze ich die artifiziellen Welten von Fantasy besonders, noch habe ich mich vom klassischen Animationsfilm je wirklich begeistern lassen. Meine partielle Ignoranz aber verdankt sich auch der Tatsache, dass der Animationsfilm zu selten ein ernstgenommener Gegenstand der Filmkritik ist. So zum Beispiel in der „Zeit“-Kritik zu Jonas Poher Rasmussens dokumentarischem Animationsfilm „Flee“ (2021), dessen besondere Machart dem Autor keine spezielle Erwähnung wert ist. Auf diese Weise bleiben Animationsfilme reine Container für eine Geschichte mit Message – formal werden sie unsichtbar gemacht. Oder aber sie werden von einigen wenigen, die alle differenzierenden Feinheiten beherrschen und mühelos mit Begriffen wie Kodomo, Shōjo, Shōnen oder Josei jonglieren können, zum Fetisch erhoben. Beide Seiten, die Ignoranten und die Aficionados, entziehen sich gleichermaßen der ästhetischen Aufklärung: Für die einen ist die Machart nicht der Rede wert, für die anderen die Faszination selbstverständlich. Auf der Strecke bleibt, warum ein spezieller Animationsfilm besonders gut sein soll.
Zur Vorbereitung für diesen Text bin ich, weil ich um die Sparte bislang einen weiten Bogen gemacht habe, in den Selbstversuch gegangen und habe erstmals eine Animationsfilmkritik geschrieben. Herausgepickt habe ich mir Masaaki Yuasas „Inu-Oh“ (2021), den wir für die Woche der Kritik Berlin Anfang des Jahres programmiert hatten – gegen meinen Widerstand im Auswahlteam. Befürworter des Films war ein der Japanologie und dem Animationsfilm sehr zugetaner Kollege, aber auch er konnte nicht, mit den Kriterien oder in den Worten der Filmkritik, plausibel machen, weshalb dieser Film es verdient haben sollte, es als erster Animationsfilm seit Gründung der Woche der Kritik 2015 ins Programm zu schaffen.
Ein Geständnis: Ich kann mit Animationsfilm einfach nichts anfangen. Als Programmerin von Experimentalfilmen beim Filmfestival UNDERDOX weiß ich aber, dass der Zugang zu bestimmten Filmsparten im Grunde verbaut ist, wenn man schlicht und ergreifend zu wenig über sie weiß. Was also wäre zu erwarten, wenn ich eine Kritik zu einem Animationsfilm schreibe, obwohl ich mich hier eigentlich nicht auskenne? Fest steht: eine Kritik im Sinne einer urteilenden Auseinandersetzung (was ein restriktiver Begriff von Kritik wäre) ist nicht möglich. Also habe ich mich zunächst in die Beschreibung verlegt, sodann in die Recherche geflüchtet. Während ich schrieb, kam mir dann ein anderer Film in den Sinn, der mir eine wichtige Brücke gebaut hat: Sumiko Hanedas „Into the Picture Scroll – The Tale of Yamanaka Tokiwa“ (2004), eigentlich ein Dokumentarfilm im oben definierten Sinne, fährt er doch mit der Kamera die historische Bildrolle aus dem 17. Jahrhundert entlang, auf der sich sukzessive eine alte Legende entrollt. Wir hatten den Film, der 2004 vom Berliner Arsenal Institut in Deutschland erstmals gezeigt wurde, bei unserer allerersten Ausgabe von UNDERDOX programmiert, was dafür spricht, dass wir von diesem Film fasziniert waren. Die Schnittstelle von Dokument und Experiment erschien uns verblüffend, und einen fiktionalen Film allein daraus zu machen, dass man ein Dokument abfilmt, ist eine überraschende Volte. Dass dies aber auch ein animierter Film sein könnte, kam mir damals nicht in den Sinn.
Dafür jetzt umso mehr, während ich über „Inu-Oh“ schrieb. Animiert ist, wenn beseelt wird, führte ich „Anime“ an die ursprüngliche Wortbedeutung zurück, wenn den künstlichen Welten Leben eingehaucht wird. Das mechanische Betätigen der Rolle in „Picture Scroll“, festgehalten durch die Kamera, greift eine frühe Idee des Kinos auf. Das Anime an sich erscheint unter dieser Perspektive in besonderer Weise geeignet, von den Anfängen der japanischen Kultur und den Künsten zu erzählen – und „Inu-Oh“ handelt genau davon, unter anderem geht es um die Ursprünge des Nō-Theaters. Ich hatte ein Argument gefunden. Plötzlich erschien mir das Anime ästhetisch unhintergehbar, gar notwendig zu sein. Begeisterung kam auf.
Die animierten Bilder als Frühform des Kinos zu betrachten, hat mich bei dieser ersten ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Animationsfilm also erst einmal gerettet. Andere Beispiele fallen mir ein: Was, wenn nicht ein Animationsfilm, ist zum Beispiel „The Horse in Motion“ (1887) von Thomas Edison? Um zu untersuchen, ob ein Pferd an einem Zeitpunkt X alle Viere in der Luft hat, schuf er zusammen mit dem britischen Fotografen Eadweard Muybridge eine chronofotografische Serie, die mittels des Kinetoskopen oder „Bewegungssehers“ abgespielt wurde und die Fotos in Bewegung brachte – oder: sie animierte.
Ähnlich andere primitive Vorformen des Kinos. Das Daumenkino kennt jedes Kind, auch heute noch wird in filmdidaktischen Kursen zuerst gezeichnet und dann gebastelt, was das Zeug hält. Und siehe da: Minimale Verschiebungen des Dargestellten und eine gewisse Geschwindigkeit beim Durchblättern der Bilder bringen die Zeichnungen in Bewegung. Das ist vor allem auch eine Faszination an der Technik und der optischen Illusion. Weiß man zu viel, verliert sich der Effekt auch wieder: Den Besuch im Animations-Studio der „Sendung mit der Maus“ zu Schulzeiten, weil ich mit dem Sohn von „Maus“-Animateur Friedrich Streich in eine Klasse ging, fand ich faszinierend, aber auch desillusionierend. Die Zeichner der Animationen, die im Atelier an ihren Tischen aufgereiht saßen (es waren die frühen Achtzigerjahre), waren für mich vor allem fleißige Bienchen, die im Akkord arbeiteten.
Apropos Bienchen. Eine Kindheit in den Siebzigern und Achtzigern bringt natürlich entsprechende Fernseherlebnisse mit sich. Da sind Hiroshi Saitōs „Biene Maja“ (1975-80) und „Wicki und die starken Männer“ (1974-75). Da gibt es die Klassiker wie Walt Disneys „Mickey Mouse“ (ab 1928) oder Bob Clampetts „Schweinchen Dick“ (1964-1972) und den im großen Studio von Metro-Goldwyn-Mayer entstandenen „Tom und Jerry“ (1940-1967). Dann gibt es auch noch aus dem europäischen Raum Bruno Bozzettos „Herr Rossi“ (1960-77), Annette Tisons „Barbapapa“ (1974-77) und Zdeněk Milers „Der kleine Maulwurf“ (ab 1957).
Zeichentrick siedelt sich mit dieser Liste unweigerlich in der Kindheit an, sogar im zweifachen Sinne. Auffällig sind die wiederkehrenden großen Glupschaugen, gleichermaßen in den japanischen Animes „Biene Maja“ und „Wicki“, aber auch in allen anderen Spielformen, bei den US-Figuren, den italienischen, französischen und tschechischen. Das Kindchenschema gehorcht der Biologie, das wissen wir von Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Große Kulleraugen, verschobene Proportionen, eine Betonung der Körpermitte, kurze Gliedmaßen sprechen die Beschützerinstinkte an und führen zu Niedlichkeitseuphorie – was sogar bei Gegenständen funktioniert. Die beliebten Zeichentrickfilme von Disney, Hayao Miyazakis umjubelter Anime „Das wandelnde Schloss“ (2004), auch die gefeierten Pixar-Filme wie „Toy Story“ (1995) oder „Findet Nemo“ (2003) drücken also nur besonders erfolgreich unsere biologischen Knöpfe. Das Schema all dieser großen Produktionen: Auf den Reiz folgt die unmittelbare, intuitive Reaktion der Betrachter. Das funktioniert sogar für den Horrorfilm, wie in Tim Burtons „Frankenweenie“ (2013) oder Henry Selicks „Coraline“ (2009).
Unter dem Vorzeichen der Filmkritik ist bei diesem Reiz-Reaktions-Muster der Animationsfilme allemal Misstrauen geboten. Filmkritik und Kritik generell sollte Manipulationsstrategien durchschauen, egal ob mit dem Streichorchester im Score „überwältigende“ Emotionen hervorgerufen werden, oder in einer suggestiven Montage kognitive Botschaften im Hirn der Zusehenden gesät werden, wie zum Beispiel im Propagandafilm. Denn gerade das zwangsläufig Schematische einer Zeichnung ist geeignet, einfache Botschaften zu transportieren. So die Zementierung von Geschlechterrollen und stereotypem Aussehen in den Disney-Klassikern wie „Die Schöne und das Biest“ (1991), die Umarmung der lustigen und gemütlichen Dicken in „Ice Age“ (2002) oder das Diversity-Washing der Stereotype wie in Disneys „Pocahontas“ (1995).

HIT THE ROAD © EGG Sabine Redlich
Zeichnungen sind notwendig Vereinfachung, Stilisierung, auch Symbolisierung. Selbst anspruchsvollere, sich an ein erwachsenes Publikum richtende Filme transportieren oft eine „neue Naivität“, die nach dem französischen Phänomenologen Paul Ricoeur eine „vorrationale Symbolkraft“ entfaltet. Wenn komplexes Leiden auf wenige Striche heruntergebrochen wird, wie in Simon Schnellmanns durchaus erschütterndem Chemo-Therapie-Kurzfilm „Bis zum letzten Tropfen“ (2021), und Genderfragen fröhliches Leben eingehaucht wird, wie in Sabine Redlichs Eisprung-Film „Hit the Road, Egg!“ (2021) und dem Enthaarungs-Film „Glückspfad“ (2021) des Trios Thea Sparmeier, Pauline Cremer und Jakob Werner, dann bekommen wir es hier auch mit didaktischen Symbol- oder Platzhalterfilmen zu tun, die einfache Botschaften verbreiten, so raffiniert die Zeichnungen auch sein mögen.
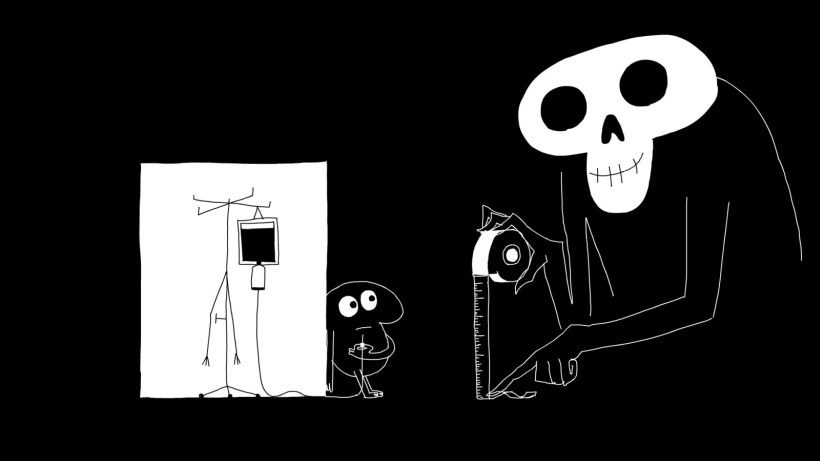
BIS ZUM LETZTEN TROPFEN © Simon Schnellmann
Zum Glück gibt es, siehe das Daumenkino, siehe die japanische Bildrolle, die Anfänge des Kinos. Lotte Reinigers Scherenschnittfilm „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ von 1926 war ein Stop-Motion-Film mit realen Papierfiguren – und der erste abendfüllende Animationsfilm der Geschichte. Stop Motion ist eine Animationstechnik der Frühzeit des Kinos, Georges Méliès bediente sich ihrer, um seinen fantastischen „Le Voyage dans la lune“ (1902) zu erzählen. Hier ist der Animationsfilm kein Gegensatz zum Realfilm mehr, er steht mit seinen Kadrierungen, Plansequenzen und Montage der siebten Kunst des Films viel näher. Vielleicht sollte man den gezeichneten Animationsfilm aber lieber einer anderen Kunst als dem Kino zuschlagen – etwa der bildenden Kunst, oder, wenn viel Computertechnik ins Spiel kommt, der Kreativkunst (Games wären hier eine Untersparte). Es kann dann viel mehr um die künstlerische oder technische Fertigkeit der Zeichnungen gehen. Gemeint sind jetzt aber nicht die ärgerlichen „Wie haben Sie das gemacht?“-Museums-Filme wie Dorota Kobielas und Hugh Welchmans Van-Gogh-Krimi „Loving Vincent“ (2017) oder Lech Majewskis Brueghel-Rekonstruktion „Die Mühle und das Kreuz“ (2011). Hochgradig künstlerische Filmen sind eher wie die der Surrealisten René Laloux und Roland Topor („La planète sauvage“, 1973), die dann schnell als „experimentell“ klassifiziert werden, weil sie aus dem Kindchenschema ausscheren. Oder auch die gefeierten Animationsfilme des Malers Jochen Kuhn wie „Sonntag 1-3“ (2005-12), die konsequenterweise bei Festivals wie „Kino der Kunst“ ihren Platz finden.

DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED © Deutsches Filminstitut Filmmuseum Frankfurt
Die Filmkritik jedoch sollte nicht so tun, als wären gezeichnete oder mit viel Kunstfertigkeit geknetete und gebastelte Animationsfilme einfach nur ebenfalls Filme. Will man über sie aus der Warte der Filmkritik schreiben, sollte man bereit sein, die Borniertheit der aufgebotenen Kriterien zu durchbrechen und vom pauschalen Lob der „tollen“ Zeichnung und der „zarten Striche“ absehen und auch keinen Kniefall vor der Technik machen – sondern sich zur Meta-Ebene aufschwingen. Also auch darüber nachdenken, was die Animation bewirkt, warum sie sich vielleicht gerade aufdrängt. Warum beispielsweise ist ein gezeichneter Dokumentarfilm wie Ari Folmans „Waltz with Bashir“ (2008) tatsächlich gut? Warum ist Marjane Satrapis „Persepolis“ (2007) herausragend? Warum ist Marc Wieses in großen Teilen gezeichneter „Camp 14“ (2012) die einzige Möglichkeit, das Nichtdarstellbare erlebbar zu machen? Und: Warum ist es folgerichtig, wenn DOK Leipzig den Animations- und Dokumentarfilm nebeneinander programmiert? Die Filmkritik sollte aber auch nicht davor zurückscheuen, Naivität und Regression zu benennen, so sie denn in den Filmen zu finden sind. Dass dies auch einen eigenen Wert und seinen Reiz haben mag – auch darüber ließe sich trefflich nachdenken. Wenn aber das Wissen über die Filme eigentlich nicht ausreicht, um adäquat über sie zu schreiben, sollten auch das eigene Fremdeln und die Unsicherheiten benannt werden. Wie in diesem Text. Weshalb auch die Angst der Filmkritik vor dem Animationsfilm nicht vergehen wird.